Journalismus und Fantasie schließen sich aus – oder doch nicht? Sind Recherchefahrten in die eigene Traumwelt möglich? Ein Selbstversuch.
Als Kind habe ich immer darauf gewartet, dass jemand einen Videorekorder für Träume erfindet. Wie genial wäre es, die nächtlichen Ausgeburten der Fantasie am nächsten Morgen im Fernseher anzusehen? Diese Idee fasziniert mich bis heute. Aber wozu bin ich Journalist?! Was, wenn ich meine Eindrücke in der kurzen Phase des Aufwachens, dem Dämmerzustand zwischen Schlaf und Wachsein, einfach aufschreibe und daraus einen Artikel bastele? Let’s try it out!
Vorrede
Im Traum sind die Mechanismen der realen Welt außer Kraft gesetzt: Raum, Zeit, gesellschaftliche Konventionen – wenn ich mich abends in die Bettdecke kuschele, hänge ich all dies an einen imaginären Nagel, an dem sie bis zum nächsten Morgen auf mich warten.
Alles ist möglich in meinen Träumen: Ich bin Geistern und toten Verwandten begegnet, habe gegen tollwütige Hunde, Rieseninsekten und verrückte Zahnärzte gekämpft. Mehrmals habe ich meine Traumfrau getroffen oder den Sinn des Lebens entschlüsselt – nur um beides wieder zu verlieren.
Doch Antworten, die man im Traum auf dringende Lebensfragen findet, und Menschen, denen man im Traum begegnet, lassen sich leider nicht in die reale Welt herüber retten. Mit den ersten Minuten des Wachseins entgleiten die Details, verblassen die Gesichter.
Was im Traum noch absolut vernünftig und logisch erschien, verpufft im Wachzustand zu einem Knäuel widersprüchlicher Gedanken. Träume, so scheint es, haben keine Daseinsberechtigung in der wachen Welt.
Die Idee zu diesem Selbstversuch kam mir zum ersten Mal im Juni 2009. Aus dieser Zeit stammt auch noch der obenstehende Traum. Jetzt soll das Experiment weitergehen. Mal schauen, was draus wird…
Traum #2 / 29.1.2020:
Eiscremeschaumparty mit Til Lindemann
Berlin. Ein Mensch fragt mich: Warst du nicht bei der Neujahrsfeier mit Til Lindemann? Die sei Kult. Cut. Til Lindemann von Rammstein zählt mit Blick aufs Rote Rathaus von irgendeinem anderen Berliner Wahrzeichen zum Neuen Jahr und läutet es mit lauten, atonalen, schrägen, harten Techno-Beats ein, zu denen alle abgehen.
Ein Eiscreme-Truck wie aus einem Karnevalsumzug oder einer Techno-Demo fährt mit einer Eiscreme-Schaumkanone durch die Massen und verschenkt Eiscreme – offenbar seit längerem schon ebenfalls eine Neujahrstraditiom. Alle tanzen im Eiscremeschaum und haben etwas abbekommen.
Ich will auch, aber zuerst muss ich ein Eiscremeschaumportraitfoto von einer Freundin mit meiner Instax machen, probiere aber zu viele Positionen aus, bis das Licht endlich passt. Schließlich ist es schon ziemlich dunkel, der Blitz muss richtig eingesetzt werden. Aber jetzt ist der Eiscremeschaum schon ganz von ihrem Gesicht geschmolzen – und das besondere Motiv futsch.
So viel Müll, so viel Schaum
Ich gehe zurück zum zentralen Marktplatz, um noch etwas Eiscremeschaum abzubekommen und zu probieren, er sieht lecker aus, aber der Truck fährt gerade zurück in das Firmenhauptquartier. Ich folge ihm, die beiden Firmengründer – beide ihrer Aufgabe langsam überdrüssig – rufen mir noch herüber: Hier ist jetzt Schluss! Aber draußen sei noch genug – und sie zeigen auf einen großen, rechteckigen Platz vor ihrer Firma, auf dem noch Unmengen riesiger bunter Eiscremeberge wie am Boden gestrandete Wolken liegen (alle in den gedeckteren Pastelltönen der Hipstereisdielen, die jeweils verschiedene Geschmacksrichtungen symbolisieren).
Zudem liegen dort Unmengen an benutzten Bechern und Gläsern, Glas, Wegwefplastik und auch einige Refillbecher darunter, aber noch wenige. Ich bin begeistert und gierig und suche nach dem größten noch sauberen Becher, um mir möglichst viel mitzunehmen. Aber irgendwie sind mir alle zu dreckig und zu ekelig oder schon gesprungen und damit zu scharfkantig und mir zu gefährlich, um sie noch zu benutzen.
Gerade, als ich die Eiscreme einfach so in die Hand nehmen und probieren will, klingelt der Wecker.
Traum #1 / Juni 2009:
Porträt eines Mannes, den es gar nicht gibt
Heute morgen bin ich mit dem unguten Gefühl aufgewacht, die Deadline für einen wichtigen Artikel zu verpassen. Vor meinem Auge formte sich das Bild eines alten asiatischen Mannes und seiner Frau. Es war nur ein Traum gewesen. Das Portät habe ich trotzdem geschrieben.
Er trägt ein beiges Hemd aus Leinen, meinem Geschmack nach ist ein Knopf zuviel geöffnet. Darunter glänzt ledrige Haut, von mehreren Jahrzehnten an der Sonne dunkelbraun gegerbt und faltig. Seine Augen sind schmal, asiatisch. Ich weiß, dass er Japaner ist. Keine Ahnung, woher diese Information stammt. Ich weiß es einfach. So wie man vieles einfach so weiß in seinen Träumen. Während meines gemeinsamen Tages mit ihm wird er mir nie seinen Namen verraten. Ich nenne ihn jetzt Herrn Lu, der Name fühlt sich richtig an. In meiner Traumwelt ist Herr Lu berühmt, aber auf berüchtigte Art. Herr Lu ist kein freundlicher Mensch. Er ist Choleriker. Ein Störenfried.
Japanischer Einsiedler
Still steht Herr Lu nie, ständig fuchteln seine Arme hin und her, während er mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er erinnert mich an Stan, den Sargverkäufer von Monkey Island. Dummerweise weiß ich von dem, was mir Herr Lu über sein Leben berichtet hat, nicht mehr viel. Der Block, den ich in meinem Traum mit Notizen voll gekritzelt habe, hat den Transit in die Realität nicht überstanden. Aber ich erinnere mich noch, wie Herr Lu lebt: Mitten im Wald bewohnt er ein kleines Holzhaus samt Veranda. Schrebergartenstil. Einen Moment lang liegt der Wald in Wellendorf, einem kleinen Ort im Südkreis Osnabrück, in dem ich aufgewachsen bin, dann wieder in der Nähe des Kanals in Münster, meinem derzeitigen Studienort.
Meine Augen bleiben bei einem Glasschaukasten auf der Veranda hängen. Vielleicht kennen Sie diese vergilbten Infotafeln, die entlang von Wanderwegen aufgestellt werden? Diesen Kasten hat Herr Lu eigenhändig gezimmert. Statt Flora und Fauna gibt es seine Lebensgeschichte. Die Erinnerung an ihn müsse der Nachwelt erhalten bleiben, sagt er. Je mehr ich von diesem Mann erfahre, desto klarer wird mir, warum meiner Redaktion an einem Porträt dieses alten Kauzes gelegen war – und warum ihn sein gesamtes Umfeld für verrückt hält.
Rennfahrer aus Leidenschaft
Kurz nach dem Krieg, welchem auch immer, war Herr Lu nach Deutschland ausgewandert und hatte das Stück Land im Wald gekauft. In Japan kannte man ihn damals als den ersten professionellen Rennfahrer der Insel. So verkündet es jedenfalls die Infotafel, deren gesamte rechte Hälfte von der Zeichnung eines kreisrunden Rennparcours eingenommen wird. Nachprüfen lassen sich die Behauptungen von Herrn Lu nicht. In meinem Traum habe ich keinen Zugang zum Internet. Und die reale Wikipedia muss bei der Überprüfung von Fakten aus meiner Traumwelt leider passen.
Plötzlich befinden sich Herr Lu und ich auf einer langen Allee im Wald, die von einem kleinen Fluss gekreuzt wird. Während Herr Lu vorläuft, bleibe ich einige Schritte zurück und unterhalte mich mit seiner Frau, die wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Herr und Frau Lu sind seit unzähligen Jahren verheiratet, erfahre ich. Sie ist Deutsche, was unter der traditionellen japanischen Kleidung nur schwer zu erkennen ist. Plötzlich trägt sie wieder klassisch-bäuerliche Kleidung. Auch ihre Gesichtszüge wabern, scheinen sich mit jedem Mal, das ich sie anschaue, neu zu verändern. Wie bei einer Kamera, deren Automatik vergeblich versucht, einen festen Fokuspunkt zu finden, kann sich mein Gehirn nicht für eine endgültige Form für Frau Lu entscheiden. Ganz im Gegenteil zu Herrn Lu. Er bleibt immer derselbe.
Wegzolltroll
Ein kleiner Teil dieser Allee gehört zu Herrn Lus Besitz. Behauptet er zumindest. Um seinen Anpruch zu untermauern, hat der alte Japaner zahlreiche Schilder in den Boden gerammt. Jedes Mal, wenn ein Passant die Allee entlang läuft oder radelt, springt Herr Lu hinter einem Busch hervor und verlangt Wegzoll. Die meisten Passanten würdigen der Gestalt, die fuchtelnd nach Geld verlangt, keines Blickes und setzen ihren Weg schmunzelnd fort. Andere lassen sich wutschnaubend auf eine Diskussion ein. Nur den Durchsetzungsstärksten gelingt es, ihren Weg ohne Obolus fortzusetzen.
Eine junge Studentin gehört nicht dazu. Schließlich gibt sie nach und legt einige Münzen in die zerknitterten Hände des Japaners. „Ich muss dringend zu meinem Seminar“, erklärt sie mit gerötetem Gesicht, aufgelöst und den Tränen nahe. Dann schwingt sie sich auf ihr Fahrrad und verschwindet in der Ferne. In diesem Moment verachte ich Herrn Lu. „Es ist mein Land, also ist es nur recht, wenn sie dafür bezahlen“, rechtfertigt der sich. Arschloch.
Ekel Lu
Erneuter Szenenwechsel: Wir befinden uns jetzt in einer katholischen Kirche. Herr Lu, der mich plötzlich an eine japanische Version Alfred Tetzlaffs erinnert, läuft einige Meter vor mir den Mittelgang herunter. Seine Frau ist verschwunden. Stattdessen steht eine deutlich jüngere Dame an meiner Seite. Eine journalistische Kollegin, die ebenfalls einen Artikel über den cholerischen Ex-Rennfahrer schreiben muss. Sie ist gerade erst dazu gekommen, hat die Szene auf der Allee nicht mitbekommen. „Der ist ja gar nicht so schlimm, wie alle behaupten“, raunt mir meine Begleiterin ins Ohr. „Warte, bis du ihn im Gottesdienst erlebt hast!“ warne ich sie – und werde mir bewusst, dass diese Worte gar keinen Sinn ergeben.
Ich wache auf, auch wenn ich mich dagegen zu wehren versuche. So gerne hätte ich erfahren, was Herr Lu in der Kirche zu suchen hat. Aber es hilft nichts: Einmal noch höre ich die Stimme meiner Begleiterin, deren Körper sich in den ersten Sonnenstrahlen des Tages auflöst: „Er ist ein schon ein komischer Kauz. Nervig, aber ohne ihn wären wir um ein Original ärmer.“
Ich glaube, ich werde Herrn Lu vermissen – auch wenn er nur eine Ausgeburt meiner Fantasie war.



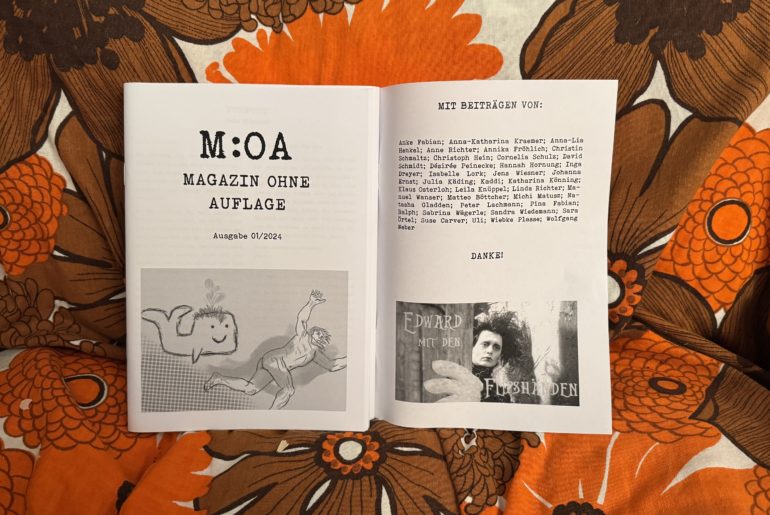






Comments are closed.