Twist & Trek: Die erste Staffel der neuen „Star Trek“-Serie „Discovery“ ist tolles Marketing, nicht mehr. Statt eine gute Geschichte zu erzählen, verzetteln sich die Macher darin, die Social-Media-Maschine zu befüttern.
Ein Freund in der fünften Klasse war es, der mich zum ersten Mal mit Jean-Luc Picard und seiner Enterprise bekannt machte. Die seltsame Mischung aus Weltraumabenteuer, Problemlösung durch Köpfchen statt Gewalt und der unbeirrte Glauben an das Gute im Menschen zog mich schnell in den Bann. Einmal ansehen und auf die nächste Wiederholung warten, reichte mir bald nicht mehr aus. Ich überredete meine Eltern, dass wir dringend einen Videorekorder bräuchten und nahm alle 178 Folgen der „Next Generation“ auf. Ja, es gab eine Zeit, als man mich mit leeren 240-Minuten-VHS-Kassetten von BASF sehr glücklich machen konnte. Nur das Gestöhne der Telefonsexwerbung störte die Utopie. Aber die Werbeblöcke waren während der nächtlichen Wiederholungen einfach kürzer als tagsüber und so passte eine Folge mehr mit auf die Kassette.
Heute sind die Zeiten, als ich zu Karneval am liebsten als Picard gegangen wäre, vorbei (und ich bin meinen Eltern echt dankbar, dass sie mir nie eine dieser überteuerten Weltraumstrampelanzugs-Uniformen gekauft und damit eine Menge Schulhofkeile erspart haben). Einen Platz in meinem Herzen hat sich „Star Trek“ trotzdem bewahrt. Die Folgeserie „Deep Space Nine“ zähle ich in bis heute zu den besten TV-Serien, die ich je gesehen habe – gerade weil sie unbequemen Fragen nicht ausgewichen ist und die utopischen Ideale vor dem Hintergrund eines grausamen Krieges auf eine harte Probe gestellt hat. Gealtert ist sie von allen Auskopplungen am besten: 25 Jahre nach ihrer Erstausstrahlung fühlt sich „Deep Space Nine“ immer noch aktuell und relevant an.
Vom Rest, der danach kam, kann man das leider nicht sagen: Sowohl „Voyager“ und die Prequel-Serie „Enterprise“ erstickten an der Angst ihrer Produzenten, die Fanbase mit Neuerungen zu verprellen. Während das Fernsehen um sie herum in ein goldenes Zeitalter des (horizontalen) Geschichtenerzählens eintrat, steckte man ausgerechnet mit einer Serie über die Zukunft strukturell in der Vergangenheit fest. Und so steuerte Captain Konrad Adenauer das feine Schiff in die Bedeutungslosigkeit: Als die „Enterprise“ 2005 ins Trockendock geschickt wurde, fühlte sich das richtig an – vor allem, weil das Ende einen neuen, besseren Anfang in sich trug: in den Begleitbüchern zur Serie. Die Bücher wurden mein monatliches „guilty pleasure“. Und weil sich niemand etwas (=Geld) davon versprach, „Star Trek“ zurück ins Fernsehen zu hieven, durften die Autoren schalten und walten wie sie wollten – selbst ehemalige Hauptcharaktere ins Jenseits befördern und das bekannte Universum an den Rande des Abgrunds stürzen. Das beste aber: Die Geschichten waren untereinander verwoben und bauten aufeinander auf – vergleichbar mit den Filmen, die das Marvel Cinematic Universe ausmachen.
Trotzdem: Als im November 2015 bekannt gegeben wurde, dass ausgerechnet Bryan Fuller an einer neuen Serie für’s Fernsehen arbeitet, war ich begeistert. Fuller, der seine ersten Drehbuchsporen bei Star Trek verdient hatte, war für einige meiner Lieblingsnischenserien verantwortlich. Das bonbonbunte „Pushing Daisies“, „Dead Like Me“, „Wonderfalls“ – und natürlich „Hannibal“, ein ästhetisch völlig abgedrehtes Experiment mit Mads Mikkelsen als reimagined cannibal with manners. Fuller könnte dem betagten Raumschiff tatsächlich neues Leben einhauchen, hoffte ich. Ein paar Monate später wurde er entlassen. Und auch wenn es für alle ersichtlich war, dass der Produktionsprozess von unzähligen Pleiten, Pech und Pannen begleitet war und der Startpunkt der neuen Serie immer wieder verschoben wurde, wurden die neuen Showrunner samt Cast nicht müde, immer wieder zu betonen, wie toll und awesome und game-changing die neue Serie doch sein. Modern wollte man erzählen – wie bei „Game of Thrones“ – und trotzdem das Alte nicht beiseite schieben. Und irgendwie auch wieder was mit Spock und Co. machen, weil: Die kennt ja jeder und sind so beliebt.
Nun ist die erste Staffel von „Star Trek: Discovery“ komplett draußen und man darf konstatieren, dass die Macher tatsächlich eine sehr zeitgemäße Serie gedreht haben – für das Social-Media-Zeitalter. Alles – die fortlaufende Geschichte, die Charakterzeichnung, die innere Logik – tritt zurück hinter das Bestreben, in jede Folge mindestens einen Twist, einen dicken WTF-Moment (Spoiler!), einzubauen, der von der aufgeregten Fanbase kommentiert, analysiert, geteilt und retweeted wird. Die wochenweise Veröffentlichung der Einzelfolgen, die nur dazu diente, dem jungen Online-Service des Fernsehsenders CBS neue Abonnenten zuzuschanzen, machte derweil die eklatanten Lücken in der Logik der Geschichten deutlich – und ließ den Fans genügend Zeit, jede Wendung vorauszuahnen.
In einem Rutsch durchgeschaut fallen die Logikbrüche nicht ganz so ins Gewicht, dafür wird umso deutlicher, dass keiner aus dem neuen Produzententeam Post-Fuller Bock auf die Gesamtgeschichte, den so genannten Arc, der die ganze Staffel umspannt, hatte. Da tobt ein existenzieller Krieg im Föderationsgebiet – und man bekommt nie das Gefühl, dass es wirklich um etwas geht. Das Universum in „Discovery“ ist winzig: Immer wieder treten dieselben paar Figuren auf, deren „Entwicklung“ von Folge 1 bis 15 so forciert geschrieben ist, dass es dem Zuschauer äußerst schwer fällt, eine echte Beziehung zu den Charakteren zu entwickeln. Die Technik hingegen funktioniert je nachdem, wie es das Drehbuch verlangt, mal so, mal so. Erst kann man mit einem neuen Antrieb innerhalb von Sekunden an jeden Ort des bekannten Universums reisen, dann plötzlich auch in Paralleluniversen und kurze Zeit später sind auch Zeitreisen möglich.
Heute endete die erste Staffel mit einem mittelmäßigen Finale, das den Krieg mehr oder weniger im Vorübergehen beendet – und mit dem größten WTF-Moment überhaupt. In den letzten Sekunden empfängt die „Discovery“ ein Notsignal – von der USS Enterprise, dem Schiff, mit dem alles begann. Und für ein paar Sekunden ist die alte 1701 tatsächlich in all ihrer Glorie zu sehen, bis die End Credits rollen und statt der Discovery-Melodie Alexanders Courages Fanfare, die alte Abspannmusik der Originalserie von 1966, zu hören ist.
Und schon diskutieren sie schon wieder alle: Wird Spock in der nächsten Staffel zu sehen sein? Wird sich das Innendesign an den knallig-roten Farben aus der Originalserie orientieren? Welcher Schauspieler wird Captain Pike spielen, den kommandierenden Offizier der Enterprise zu dieser Zeit? Ohne Frage: Marketingtechnisch ist die Serie ein Juwel. Kreativ ist sie eine Bankrotterklärung. Und das Schlimmste: Mit „Discovery“ wurden die fortlaufenden Buchreihen um Picard, Sisko, Janeway und Archer erst einmal auf Eis gelegt. In die Zukunft geht bei „Star Trek“ niemand mehr – von „boldly“ ganz zu schweigen.





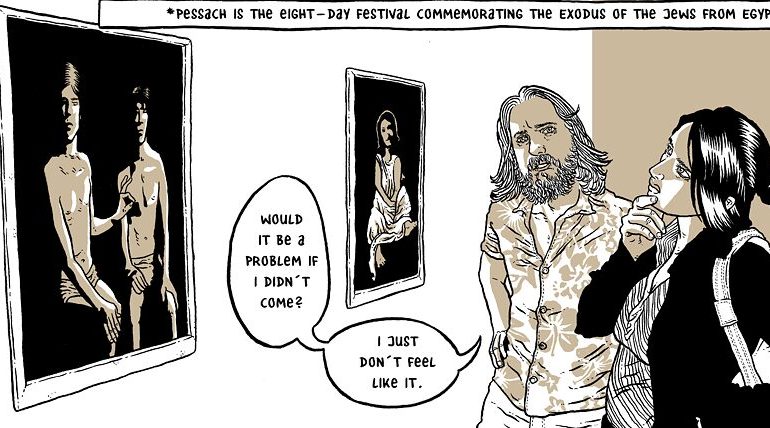




Comments are closed.