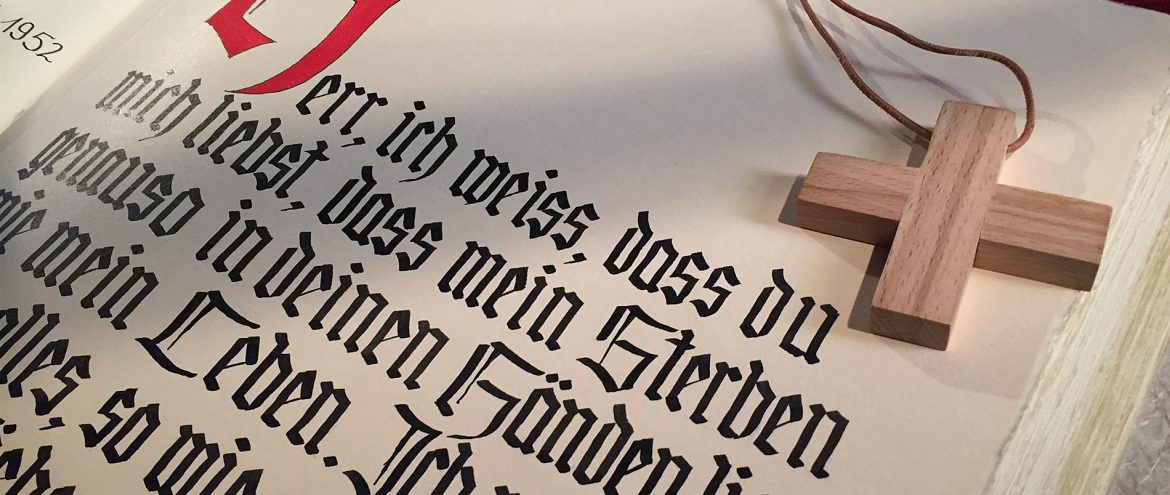Stell dir vor, es ist Beerdigung – und keiner geht hin. Die Hamburger Josephs-Gemeinde hat etwas dagegen getan und den mittelalterlichen Brauch der Beerdigungsbruderschaften wieder aufleben lassen.
Die war einfach nicht mehr da, und keiner wusste, wo sie beerdigt liegt.
So wirklich kannte die alte Dame aus dem Altersheim niemand. Aber fromm war sie – auch wenn ihre Gesundheit einen Kirchgang nicht mehr möglich machte. Einmal im Monat ließ sie sich von einer Frau aus der St.-Josephs-Gemeinde die Kommunion bringen. Bis zu jenem Tag, an dem ihr Bett plötzlich leer war. Weil niemand für ihre Beerdigung aufkam, zahlte die Sozialbehörde. Abtrag, heißt das im Behördendeutsch. Ein gemeines, aber passendes Wort. So bar jeglichen Gefühls, so kalt und kühl wie toter Fisch.
„Die war einfach nicht mehr da, und keiner wusste, wo sie beerdigt liegt.“ Noch immer schwingt Bestürzung in Brigitte Hackmanns Stimme mit, wenn sie sich an den Moment vor rund 15 Jahren erinnert. „Das hätte ja nichts gekostet, wir wären alle mitgegangen.“ Die 76-Jährige war 2002 Mitglied im Pfarrgemeinderat, als Pfarrer Markus Tymister einen besonderen Vorschlag unterbreitete: Der Geistliche wollte einen alten Brauch wieder einführen, der bis ins Mittelalter zurückreicht – den der Beerdigungsbruderschaft. Solche Bruderschaften sorgten in jenen Zeiten dafür, dass allen Menschen – auch den ärmsten in den Städten – eine würdige Bestattung zuteil wurde. Brigitte Hackmann gefiel der Gedanke. Bis heute kümmert sich die ehemalige Grund- und Hauptschullehrerin um die Bruderschaft, wirbt in der Gemeinde neue Mitglieder an, gibt telefonisch Termine durch und sorgt für Mitfahrgelegenheiten zum Friedhof.
Ehrendienst am Sarg
Um den Ausgleich von Finanzierungsproblemen geht es beim Dienst der Hamburger Bruderschaft aber nicht: Ihre Mitglieder – derzeit 25 Frauen und Männer – wollen dem Toten das letzte Geleit erweisen und Angehörigen Trost spenden. Die Bruderschaft tritt nämlich nicht nur dann auf den Plan, wenn der Verstorbene niemanden oder fast keine Angehörige und Freunde hinterlässt. Auch wenn sich herauskristallisiert, dass die Hinterbliebenen mit der Kirche, ihren Gesängen und Ritualen nur wenig Erfahrung haben, schlägt der Pfarrer einen Einsatz vor.
„Es gibt ja Leute, die noch nicht mal ein ‚Vaterunser‘ sagen können, das ist dann schon sehr unangenehm, auch für den Pfarrer“, weiß Dieter Nachtigäller zu berichten. Nach seinem Ruhestand als Frauenarzt begann sich der 77-jährige Wandsbeker in der Bruderschaft zu engagieren: „Eine Gemeinde zu sein bedeutet ja, von der Taufe bis zur Beerdigung über die kirchlichen Sakramente eine Gemeinschaft zu bilden. Deswegen fand ich die Idee, einen Menschen bis zu seinem Tod als Gemeinde zu begleiten, sehr gut und unterstützenswert.“ Aber wie geht man mit Angehörigen um, die ganz augenscheinlich nichts mehr mit der Kirche zu tun haben? „Die lässt man in dem Moment gedanklich fallen“, gibt Nachtigäller zu. Stattdessen konzentriere er sich lieber auf den Verstorbenen, denke daran, wie sehr dieser mit den Ideen von Kirche, Tod und Wiederauferstehung befasst war.
Es gibt ja Leute, die noch nicht mal ein ‚Vaterunser‘ sagen können, das ist dann schon sehr unangenehm.
Doch auch regelmäßigen Kirchgängern kann die Stimme versagen, wenn sie einen Angehörigen zu Grabe tragen müssen. Auch in diesen Momenten sieht sich die Bruderschaft als wichtige Stütze. Nachtigäller: „Angehörige haben uns später geschrieben, dass sie es schön fanden, nicht alleine gewesen zu sein und dass es ihnen viel Kraft und Hilfe gegeben hat – gerade auch beim Singen.“ In der Seele weh tut es den Mitgliedern der Bruderschaft allerdings, wenn sie aus dem Gemeindeblatt vom Tod eines gläubigen Kirchgängers erfahren, sich aber niemand bei ihnen gemeldet hat. „Das kommt vor – wenn die Erben mit der Kirche nichts am Hut haben und die Toten ihren Wunsch nicht schriftlich festgehalten haben„, erklärt der Ruheständler.

Der Anonymität entgegen wirken
Ohne Frage: Die Beerdigung ist ein wichtiger Schritt im Trauerprozess, um den Verlust eines Familienmitglieds, eines Freundes oder Partners zu verarbeiten. Aber muss nicht auch die Gemeinde trauern, wenn einer der ihren geht? Braucht nicht auch sie das Ritual? Oder vielleicht sogar eine Art Absolution, wenn ein Gemeindemitglied stirbt, das man – aus welchen Gründen auch immer – zu Lebzeiten nicht erreicht oder beachtet hat?
„Wir leben hier in der Großstadt sehr anonym, das ist in der Kirchengemeinde nicht anders“, fasst Karl Hufschmidt seine Beobachtungen zusammen. „Bis man wahrgenommen wird – das dauert.“ Obwohl der 75-Jährige seit zehn Jahren in der Bruderschaft aktiv ist und mit beiden Beinen fest im Gemeindeleben steht, kann er davon ein Lied singen. „Wenn hier jemand stirbt, kennt man den Verstorbenen meist gar nicht.“ Auf dem flachen Land sehe das anders aus, weswegen dort auch die Bereitschaft größer sei, den Verstorbenen zu begleiten. In St. Joseph ermutigt Pfarrer Tymister die Hinterbliebenen daher, ein Bild des Verstorbenen an den Sarg zu stellen oder weist während des Requiems auf jenen Platz in der Kirche hin, auf dem er für gewöhnlich gesessen hat – als Erinnerungsstütze für die anderen Gemeindemitglieder.
Wenn hier jemand stirbt, kennt man den Verstorbenen meist gar nicht.
Jede zweite Beerdigung wird in St. Joseph mittlerweile von der Bruderschaft begleitet. Eine Anwesenheitspflicht besteht für die einzelnen Mitglieder freilich nicht. Wer Zeit hat und sich körperlich dazu in der Lage fühlt, kommt mit. „Durchschnittlich sind zwischen 8 und 16 Leute beim Trauergottesdienst dabei“, erklärt Brigitte Hackmann. Von einer Routine möchte trotzdem niemand sprechen – auch wenn einige Mitglieder schon mehrere Dutzend Beerdigungen begleitet haben. „Ich nehme von jeder Beerdigung etwas mit. Der Ritus hat ja eine Wirkung – zumindest für denjenigen, der glaubensmäßig etwas damit anfangen kann“, ist sich Karl Hufschmidt sicher. „Wir sagen ja nicht nur Gedichte auf und singen nette Hymnen.“
„Jede Beerdigung ist anders“, meint auch Brigitte Hackmann. Und jede Beerdigung wirkt nach. Niemals werde sie vergessen, wie ein junger Mann in seiner Trauerrede die verstorbene Mutter zitierte, die Suizid begangen hatte. „Das Leben ist doch so schön“, hatte sie ihm einst nach Paris geschrieben. Für Bruderschaftsmitglied Christel Vissing war es der Moment, als ein junger Zwanzigjähriger fast zusammengebrochen wäre, als er den Sarg seines Studienfreundes tragen musste. Daneben hatte ein Kranz mit Trauerschleife gelegen: „Wenn du da oben ankommst, stell schon mal die Getränke kalt. Wir folgen dir.“
Der Tod fährt mit
Dabei fängt die Verarbeitung des Geschehens oft erst nach der Zeremonie an. „Häufig ist man im Moment der Beerdigung gedanklich gar nicht so bei dem Verstorbenen“, so Brigitte Hackmann. Das komme erst später. Als Belastung empfinde sie diese Gedanken aber nicht. Auf den Fahrgemeinschaften hin und vom Friedhof zurück werde oft über den Tod gesprochen – auch über den eigenen. Schließlich sind die allermeisten Bruderschaftsmitglieder selbst nicht mehr die jüngsten: Von einst 40 sind neun mittlerweile verstorben. Und nicht alle schaffen es mehr körperlich, den gesamten Weg über den Friedhof mitzugehen. „Sie versuchen aber, zumindest beim Requiem in der Kirche anwesend zu sein“, erklärt Hackmann.
Unser Pausenhof ging an einer Leichenhalle vorbei, da haben wir uns immer reingeschlichen.
Sicher ist: Für Brigitte Hackmann, Karl Hufschmidt, Dieter Nachtigäller, Christel Vissing und ihren Mann Horst Peter ist der Tod ein alltäglicheres Thema als für viele andere Gemeindemitglieder. Dabei fällt auf, dass viele bereits besondere Berührungspunkte mit dem Sterben hatten. Karl Hufschmidt arbeitete früher im Hospiz, Brigitte Hackmanns kleiner Bruder und ihre Großmutter starben während des Einmarschs der Roten Armee in Westpreußen und mussten im Garten am Wegkreuz beerdigt werden. Später, in einem Krankenhaus in Südoldenburg, schlich sich Hackmann mit jungen Krankenschwestern in die Leichenhalle, neugierig darauf, wie die Toten aufgebahrt wurden. „Der Geruch dort war sehr penetrant – besonders im Sommer. Infolgedessen hatte ich viele schreckliche Träume.“
Ganz ähnliche Kindheitserinnerungen teilt auch Christel Vissing, die im westlichen Münsterland aufwuchs: „Unser Pausenhof ging an einer Leichenhalle vorbei, da haben wir uns immer reingeschlichen. Abends hatte ich eine solche Angst, dass ich nicht mehr in den Keller gehen wollte.“ Diese Angst ist bis heute geblieben: „Ich bringe Kranken zwar die Kommunion, aber die Vorstellung, dass ich dabei bleiben muss, wenn es zu Ende geht … Ich bin ja schon bei meinem Vater weggelaufen.“
Dabeibleiben bis zum Schluss
Brigitte Hackmann ist dabei geblieben – drei Stunden lang. Ihre Mutter, 93 und sehr fromm, hatte eine Magensonde, konnte nicht mehr sprechen. „Irgendwann hat sie die Hände hochgerissen und wollte, dass wir beten. Dann ist sie gestorben, so friedlich, es war ergreifend. Ich habe gedacht, der liebe Gott muss doch eine Freude an ihr haben.“
Auch Karl Hufschmidt hat schon einmal jemanden in den Tod begleitet – allerdings nicht ganz freiwillig. Er leitete damals ein Altenheim, als eine Schwester in sein Büro kam und ihn bat, einer sterbenden Frau beizustehen. „Ich war damals um die 50 und ehrlich geschockt. Ich kannte die Dame nicht, habe mich dann hingesetzt, ihre Hand gehalten und leise gebetet.“ Hufschmidt gibt zu, dass ihm die Situation damals sehr unangenehm war. „Die Arbeit stapelte sich unten auf dem Tisch, ich habe da länger als zwei Stunden gesessen, das ist mir so tief gegangen. Aber ich habe dann auch gedacht: Das ist jetzt deine Aufgabe hier, die Frau nicht alleine zu lassen.“