Wir schreiben des Jahr 2007. Der Ort: Münster. 24 Stunden aus dem Tagebuch eines Studenten an der Westfälischen-Wilhelms-Universität – aus einer Zeit, als es den Magister noch gab.
Es ist acht Uhr morgens, also noch mitten in der Nacht, als mich mein Wecker zum ersten Mal versucht aus dem Bett zu holen. Einen Faustschlag später ist er wieder still und ich tauche aufs Neue in Morpheus’ Traumreich ein. So findet mich mein Mitbewohner Tobi um halb elf. „Wolltest du nicht mit deiner Magisterarbeit anfangen?“ fragt er und gleich fühle ich mich wieder schuldig. Gestern Abend hatte ich eine Freundin besucht, um ihr ein Buch zurück zu bringen. Eigentliche eine Sache von fünf Minuten. Doch dann redeten wir uns fest, quatschen über unsere Zukunftspläne nach der Uni, ihre Mitbewohnerin, die noch immer nicht die Miete überwiesen hatte – und natürlich die Liebe. Nach zwei Flaschen Rotwein und einem Abschluss-Whiskey wankte sie in ihr, ich in mein Bett. Schade eigentlich.

Jetzt, da ich aufgestanden bin und ein dampfender Kaffee vor mir auf dem Tisch steht, kann ich mich auch vorstellen. Gestatten, Jens mein Name, Student der Geschichtswissenschaft im westfälischen Münster, zehntes Semester. Zehntes Semester, das bedeutet, ich habe bereits fünf Jahre Studium hinter mir und sollte so langsam fertig werden. Fluch und Segen, dieses freie Studium in Deutschland, bei dem man sich seine Zeit selbst einteilen kann: Ob ich innerhalb von vier Jahren abschließe oder sieben Jahre brauche, hängt ganz allein von mir ab.
Choose wisely!
Auch den Großteil meiner Seminare darf ich frei nach Interesse wählen: Darf es „Ehe und Familie in der griechisch-römischen Antike“ sein? Oder doch lieber „Das Hitlerbild im deutschen Nachkriegsfilm“? Nur wenige Grundlagenkurse sind für alle Studenten verpflichtend. Jeder baut sich aus seinen gewählten Seminaren ein persönliches „Spezialgebiet“ zusammen. Auch unsere Seminare sind anders als im Großteil Europas: Meistens spricht unser Professor nur einige einleitende Worte, dann sind wir dran: In Kleingruppen zu drei oder vier Personen bereiten wir ein Referat zu bestimmten Themen vor und präsentieren dies dem Plenum. Manchmal hören unsere Kommilitonen sogar zu.
Klausuren gibt es nur selten, stattdessen schreiben wir zum Abschluss eines Kurses wissenschaftliche Hausarbeiten. Am Anfang 15, später auch mal 30 Seiten. Eigentlich keine schlechte Sache: Man beschäftigt sich viel intensiver mit einem Thema und lernt nicht nur für die Klausur. Allerdings ist der zeitliche Aufwand deutlich größer. (Aber auch die Chancen zu bestehen!)
Die Mutter aller Hausarbeiten
Am Ende unseres Studiums steht die MAGISTERARBEIT. Eine Hausarbeit in groß. Vier Monate Zeit bekommen wir für 100 Seiten. Die ersten zwei Monate leben sich wie immer, dann folgt die Panik, die Zeit der sozialen Abstinenz. Eingeschlossen mit Unmengen an Tiefkühlpizzen wird das Haus nur noch verlassen, um mit seinem Professor Detailfragen zur Arbeit zu klären oder neue Tiefkühlpizzen im Supermarkt zu kaufen. Wer bislang noch nicht Kaffee- oder Zigarettenabhängig war, wird es jetzt. Ist die Magisterarbeit einmal geschafft, darf man sich allerdings zurücklehnen und eine teure Flasche Champagner öffnen. Die mündlichen Prüfungen danach sind praktisch nur noch Formsache. Soweit also die Theorie.
Lernen? Später!
Mittlerweile ist es zwölf Uhr. Zeit zum Mittagessen in der Mensa. Mensaessen, das ist wie ein Überraschungs-Ei. Manchmal freut man sich über eine tolle Figur, aber viel zu häufig gibt es nur diesen Mist zum Zusammenbauen. Heute ist das Essen glücklicherweise lecker: Hähnchenschnitzel „Cordon Bleu“ mit Kartoffelbrei für zwei Euro. Danach will ich in die Bibliothek – lernen für meine Magisterarbeit. Doch plötzlich klingelt das Telefon. Melanie ist dran, total verzweifelt. Gerade ist ihr Computer abgestürzt und alle Daten scheinen verloren. Ich verspreche vorbeizukommen und tatsächlich bekommen wir den alten Rechner wieder flott: Der Weltuntergang ist bis auf weiteres verschoben. Unser Erfolg wird mit Kaffee und Kuchen in der Küche begossen. Wir reden – über unsere Zukunftspläne nach der Uni, ihren Mitbewohner, dessen dreckiges Geschirr sich seit einer Woche in der Küche stapelt – und natürlich die Liebe. Plötzlich fällt mein Blick auf die Uhr. Scheiße, kann es wirklich schon sechs sein? Jetzt ist Bibliothek schon geschlossen.

Hauptfach: Prokrastinieren
Also zurück nach Hause, mit meiner Mitbewohnerin Anne noch eine kurze Folge „House“ geschaut und dann mit einem dampfenden Kaffee (mittlerweile mein fünfter) zurück an den Schreibtisch, einen Praktikumsplatz für die Semesterferien suchen. Theoretisch verlangt unser Studium kein Praktikum, aber welcher Arbeitgeber stellt schon einen 25-jährigen Geschichtsstudenten ein, der noch keinen Kontakt mit der Arbeitswelt hatte? Das wissen auch die Chefs und bezahlen Praktikanten dementsprechend schlecht. Deswegen arbeite ich neben dem Studium acht Stunden in der Woche als Aufsicht in der Uni-Bibliothek und schreibe als freier Mitarbeiter für zwei Münsteraner Lokalzeitungen.
Fast jeder Student in Deutschland verdient sich auf die eine oder andere Weise etwas hinzu. Sei es als Kellner, „wissenschaftliche Hilfskraft“ (=Kaffee kochen und kopieren für den Professor) oder Nachhilfelehrer. Schließlich wohnt der Großteil von uns nicht mehr im „Hotel Mama“, sondern in einer WG oder einem Studentenwohnheim. Zur Miete, Internet, täglichen Kaffeeinfusionen und Ausgeh-Kosten kommen seit vergangenem Jahr noch die Studiengebühren hinzu. Zuvor war das Universitätsstudium in Deutschland gratis, „Freie Bildung für alle“ lautete der Slogan. Doch „freie Bildung“ bringt nicht viel, wenn man mit 100 Leuten in einer Veranstaltung sitzt, die für 20 gedacht war und sich seine Stühle selbst mitbringen muss.

Ring, ring…
Plötzlich klingelt wieder das Telefon. Gesa fragt, ob ich in die Sputnikhalle möchte. Heute sei Indie-Rock-Abend und schließlich finde der nur einmal im Monat statt. Nach einem kleinen Kampf zwischen Teufelchen und Engelchen auf meiner Schulter, steht die Entscheidung fest. Um vier Uhr nachts kommen wir schließlich zurück. Zufrieden, aber völlig ausgehungert beschließen Gesa und ich, eine Runde Spiegeleier zu braten. Dazu noch eine Flasche Wein und die unvermeidbare Konversation: über unsere Zukunftspläne nach der Uni, ihren Mitbewohner, der vergessen hat, Klopapier zu kaufen – und natürlich die Liebe. Dann wanken wir beide ins Bett. Sie in ihrs, ich in meins. Schade eigentlich.
Dieser Artikel ist 2007 im polnischen, mehrsprachigen Lehrmagazin „Anglorama“ erschienen. Originalfassung als jpg hier und hier downloaden.







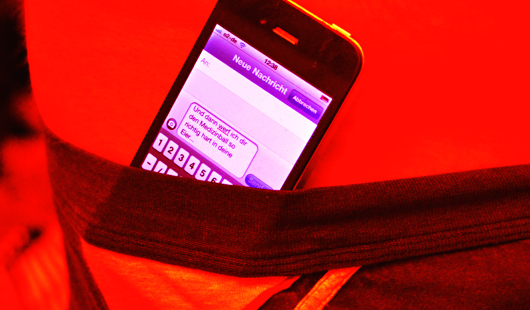


Comments are closed.